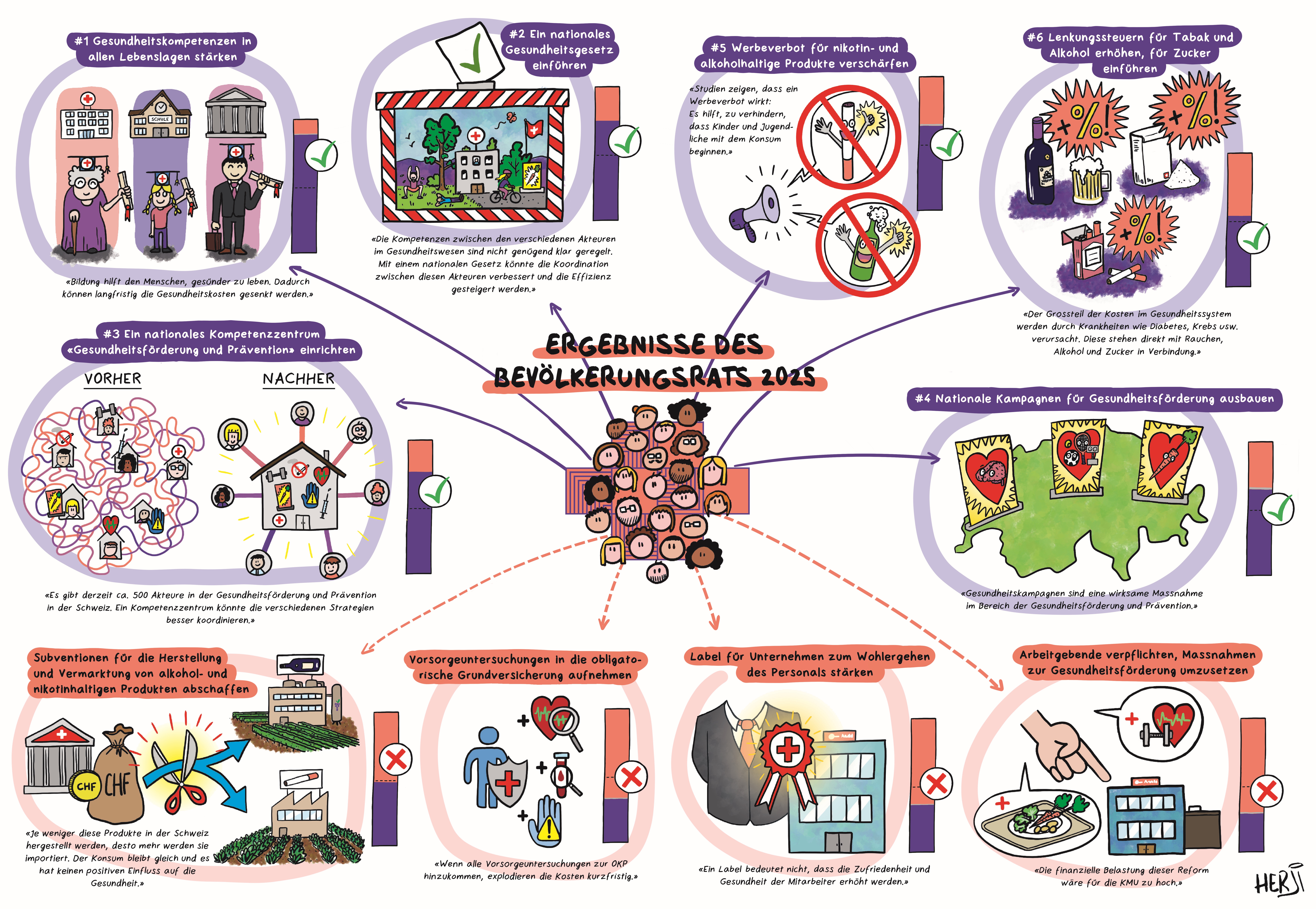Informationen zum Thema Gesundheitsförderung und Prävention
Die folgenden Informationen sind gemäss dem Bevölkerungsrat 2025 wichtig, um über das Thema
«Gesundheitsförderung und Prävention» zu diskutieren:
Systemische Herausforderungen im Gesundheitswesen
- Das aktuelle Gesundheitssystem ist auf die reaktive Behandlung von Krankheiten ausgerichtet und zu wenig auf den proaktiven Erhalt und die Förderung der Gesundheit.
- Die Gesundheitsförderung und Prävention sind in der Schweiz stark föderal organisiert, was zu Ungleichheiten in der Umsetzung zwischen den Kantonen führt. Die Koordination zwischen verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen ist zudem mangelhaft.
- Es gibt auf nationaler Ebene keine gesetzliche Grundlage, um die Gesundheitsförderung und Prävention koordiniert anzugehen und zu fördern.
- Die Umsetzung vieler Präventionsmassnahmen scheitert an politischem Widerstand. Lobbyinteressen verhindern oft eine konsequente Präventionspolitik, da Gesundheit und Krankheit auch ein Markt sind, in dem viel Geld verdient wird. Ähnliches gilt für gesundheits-schädliche Produkte.
- Das Schweizer Gesundheitswesen basiert auf dem Prinzip einer dreifachen Solidarität: zwischen jung und alt, gesund und krank sowie zwischen arm und reich
Prävention & Gesundheitsförderung in der Schweiz
- Gesundheitsförderung und Prävention sind nicht dasselbe. Gesundheitsförderung verbessert die Lebensbedingungen, damit Menschen gesund bleiben, z. B. saubere Luft, sauberes Wasser, Grünflächen, Bewegung oder gesunde Ernährung im Alltag. Prävention hingegen beugt gezielt Krankheiten vor, etwa durch Impfungen oder Vorsorgeuntersuchungen. Beide Ansätze ergänzen sich, haben aber unterschiedliche Schwerpunkte.
- Gesundheitsförderung und Prävention beginnen schon in der Kindheit. Je früher das Gesundheitsbewusstsein gefördert wird, desto eher werden langfristig positive Effekte erzielt.
- Es ist günstiger, Krankheiten vorzubeugen als sie zu behandeln. Mehr Investitionen in effektive Präventionsmassnahmen können die Gesundheitsausgaben langfristig reduzieren.
- Regelmässige Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig, um Krankheiten früh zu erkennen und schwere Krankheitsfälle zu vermeiden.
- Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, welche Massnahmen in der Prävention von nichtübertragbaren Krankheiten wirksam und kosteneffektiv sind, siehe bspw. «Best Buys» der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
- Eigenverantwortung ist wichtig. Gesundheit hängt aber nicht nur vom Individuum ab, sondern sie ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Es reicht nicht, nur an einzelne Menschen zu appellieren – es braucht auch Massnahmen, die das Umfeld gesundheitsfreundlich machen.
- Mit der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz gibt es eine nationale Institution, die Projekte zur Gesundheitsförderung anstösst, koordiniert und evaluiert.
- Es gibt die Nationale Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten. Zudem gibt es bereits viele gute Präventionsprogramme und -massnahmen, sie werden aber regional unterschiedlich gut umgesetzt und zu wenig untereinander koordiniert.
- Die Zusammenarbeit von Schulmedizin und alternativen Ansätzen kann helfen, die Gesundheit besser zu erhalten. Wenn Ärztinnen und Ärzte vermehrt auch Naturheilkunde und Alternativmedizin einbeziehen, entstehen mehr Möglichkeiten für eine ganzheitliche Behandlung.
Kosten & Finanzierung von Gesundheitsförderung und Prävention
- Rund 80 % der Gesundheitskosten in der Schweiz werden durch nichtübertragbare Krankheiten – wie Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen - verursacht. Mit einem gesunden Lebensstil liessen sich rund die Hälfte der nichtübertragbaren Krankheiten vermeiden oder verzögern.
- 2022 wurden insgesamt 92,9 Milliarden Franken für das Gesundheitswesen aufgewendet. Am meisten Kosten verursachten Behandlungen und Pflege in Arztpraxen, Spitälern und Heimen (ca. 65 %). Zudem führt der demographische Wandel (alternde Bevölkerung) zusätzlich zu steigenden Ausgaben für chronische Krankheiten und Langzeitpflege.
- Den Grossteil der Ausgaben im Gesundheitswesen tragen die Haushalte (ca. 60 %). Bund, Kantone und Gemeinden finanzieren rund 32 % der Kosten. Unternehmen und weitere Finanzierungsquellen tragen ca. 8 % der Gesundheitsausgaben.
- Für die Gesundheitsförderung und Prävention wird nur ein kleiner Teil der gesamten Gesundheitsausgaben ausgegeben. Zwischen 2016 bis 2019 lag der Anteil der Ausgaben für Gesundheitsförderung und Prävention bei ca. 1,7 %. 2022 stiegen die Ausgaben aufgrund der Kampagnen für Impfungen und Tests der Covid-19-Pandemie auf ca. 4,2 % der gesamten Gesundheitsausgaben.
- 2022 fiel mit 61 % der grösste Teil der Präventionsausgaben Corona-bedingt auf Leistungen zur Prävention übertragbarer Krankheiten (zwischen 2016 und 2019 lag dieser Anteil deutlich tiefer bei 7 bis 11 %). Rund 20 % wurden 2022 für die Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung eingesetzt. Ca. 18 % der Präventionsausgaben verteilten sich auf Präventionsmassnahmen in den Bereichen Sucht, psychische Gesundheit, Unfälle & Verletzungen und Bewegung & Ernährung.
- Die durch übertragbare Krankheiten verursachten Kosten sind vergleichsweise gering. Unter anderen deshalb, weil die zugehörigen Präventionsmassnahmen wirksam sind.
- Die Leistungen für Gesundheitsförderung und Prävention werden aus verschiedenen Quellen finanziert (u.a. Alkoholzehntel, Tabakpräventionsfonds, Gesundheitsförderung Schweiz). Die uneinheitliche Finanzierungsstruktur erschwert es, die vorhandenen Mittel effizient einzusetzen und Synergien zu nutzen.
Gesundheitskompetenzen der Schweizer Wohnbevölkerung
- Viele Menschen wissen nicht genau, wie das Schweizer Gesundheitssystem funktioniert. Knapp die Hälfte der Schweizer Bevölkerung hat Schwierigkeiten, mit Gesundheitsinformationen umzugehen und sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden.
- Gesundheitskompetenz ist die Basis, damit Menschen gute Entscheidungen für ihre Gesundheit treffen können. Es gibt bereits viele Gesundheitsinformationen und Angebote, aber sie sind oft nicht bekannt oder schwer verständlich. Insbesondere benachteiligte Bevölkerungsgruppen werden schlechter erreicht. Damit mehr Menschen ihre Gesundheitskompetenzen stärken können, müssen die Informationen verständlich und zugänglich sein und besser kommuniziert werden.
- Gesundheitsbildung ist eine einfache und günstige Möglichkeit, Menschen für ihre Gesundheit zu sensibilisieren und ihnen wichtiges Wissen zu vermitteln. Sie sorgt dafür, dass alle – unabhängig von ihrer sozialen oder finanziellen Situation – die gleichen Informationen erhalten und dadurch besser für ihre Gesundheit sorgen können.
- Jeder und jede kann durch kleine Änderungen am eigenen Lebensstil einen Beitrag zur eigenen Gesundheit leisten. Dazu gehören u.a. viel Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und gute menschliche Kontakte. Mit einem gesunden Lebensstil könnte ein Grossteil der nichtübertragbaren Krankheiten vermieden oder verzögert werden.